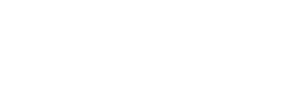Ein Bericht von Hartmut Rüf
Im August 1998 berichteten die Zeitungen in Bayern, im kleinen Ort Bernstorf bei Freising hätten zwei Hobbyarchäologen im Bereich einer bronzezeitlichen Siedlung einen Goldschatz gefunden. Unter einer Wurzel eines umgestürzten Baumes versteckt fanden sich ein Ensemble aus verzierten Goldblechen, eine Art Diadem, Teile eines Gürtels, Anhänger, eine Nadel und ein mit Goldblech umwickeltes Zepter, alles in einer Lehmhülle.
Im Jahr 2000 wurden die zwei Hobbyarchäologen wieder fündig, diesmal mit Bernsteinamuletten, das eine mit einer Gesichtsdarstellung ähnlich einer im griechischen Mykene gefundenen Goldmaske, die als Totenmaske des Agamemnon bekannt ist. Am anderen sind Schriftzeichen in Linear B eingraviert, der Schrift des bronzezeitlichen Kreta.
Bereits früh wurde man mit Werten von 99% auf unüblich hohe Goldgehalte der Goldbleche aufmerksam. Der Archäologe Rüdiger Krause, Professor für Vor- und Frühgeschichte an der Uni Frankfurt, der Nachgrabungen durchführte, sowie Rupert Gebhard, Leiter der Archäologischen Staatssammlung München,
argumentierten mit einer Herkunft des Goldes aus Ägypten auf Grund der Ähnlichkeit der Zusammensetzung mit dem Gold der Sargwanne des Pharaos Echnaton.
Schlagzeilen, die die Medien gerne aufnahmen, konnte man nun doch den Fundort als das Troja Bayerns und Bayern als die Drehscheibe zwischen der Nordsee und Ägypten bezeichnen.
Der angenommenen Bedeutung der Funde wurde im Jahre 2014 mit der Errichtung des Bronzezeit Bayern Museums Rechnung getragen.
Das Hochgefühl wurde jedoch stark gedämpft mit dem Bekanntwerden einer Untersuchung der Goldproben im Labor des ausgewiesenen Spezialisten für Analysen prähistorischer Metallfunde, Prof. Ernst Pernicka. Pernicka fand mit neuen Analysenmethoden nun bei den Proben von Bernstorf einen Goldgehalt von 99,99%. Dieser Wert entspricht der Zusammensetzung modernen mittels Elektrolyse erzeugten Goldes. Die Resultate wurden später bei einer Schiedsanalyse bei der deutschen Materialprüfanstalt in Berlin bestätigt.
Im Vergleich dazu ist natürliches Gold immer mit etwa 5-25% Silber und Kupfer vergesellschaftet, der Edelmetallgehalt der Goldapplikationen der bronzezeitlichen Himmelsscheibe von Nebra liegt z.B. zwischen 80% und 87%. Der Goldgehalt der Berntorffunde liegt somit dramatisch über den für Funde aus der Bronzezeit zu erwartenden Werten.
Gebhard und Krause argumentieren, das Gold wäre mit einem Prozess, genannt Zementation, auf diese extremen Goldgehalte aufgereinigt worden,
es stellt sich jedoch die Frage, warum die bronzezeitlichen Handwerker dies hätten tun sollen. Der Sinn einer derartigen Vorgangsweise wäre nicht nachvollziehbar, die Farbe, Härte und Verarbeitbarkeit von 99%igem Gold ist dieselbe wie bei einem Reinheitsgrad von 99,9% oder gar 99,99%, Unterschiede sind ohne chemische Analyse überhaupt nicht zu erkennen. Es ist daher nicht sehr plausibel, dass in prähistorischen Gesellschaften dieser Aufwand betrieben worden wäre, abgesehen davon, dass bei der Reinigung Gold verloren geht.
Als wäre dieses Argument nicht schon eine „rauchende Pistole“ genug, gibt es noch eine Reihe anderer Ungereimtheiten. So wurden die Goldbleche nach einer Technik hergestellt, die erst im 15.Jahrhundert erfunden wurde, sowie verzahnt mit den Folien wurde eine Fichtennadel jüngster Provenienz gefunden.
Die Mehrheit der Wissenschafter hält das Ensemble aus Goldblechen und Bernsteinobjekten für eine Fälschung. Nichtsdestotrotz blieben Gebhard und Krause bei ihrem Standpunkt und veranstalteten zur Bestätigung ihrer Beurteilung der Funde einen Kongress. Eingeladen als Vortragende wurden jedoch nur Referenten, die die Meinung der Befürworter teilten. Im Tagungsband war dabei für den Vortrag einer Dame, die leise Kritik übte, leider kein Platz mehr.
In der Folge gab es unfreundliches Hin und Her mit Retourkutschen für Kritiker (auf einen Artikel von Prof. Dr. Meller hin, dem Leiter des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle und Hüter der Himmelsscheibe von Nebra, wurde die Datierung dieser in die Bronzezeit in Zweifel gezogen)
Zuletzt hat leider das Niveau der Diskussion seitens der Befürworter ein unterirdisches Niveau angenommen.
Es ist wohl bei Berücksichtigung des finanziellen Aufwandes (Errichtung des Museums um 600.000 €), sowie der wissenschaftlichen Reputation der beteiligten Personen die Aussage zulässig: „Too big to fail“.
Verwendete Literatur (chronologisch geordnet):
Rupert Gebhard: Der Goldfund von Bernstorf, Bayerische Vorgeschichtsblätter 64, 1999, S. 1-18. Tafel 1-8
Rupert Gebhard und Karl Heinz Rieder: Zwei bronzezeitliche Bernsteinobjekte mit Bild- und Schriftzeichen aus Bernstorf (Lkr. Freising) GERMANIA 80, 2OO2, S. 115-133
Ernst Pernicka: Zur Frage der Echtheit der Bernstorfer Goldfunde, in Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 11/I 2014 Metalle der Macht – Frühes Gold und Silber, S. 247-56
Ernst Pernicka: Echt oder falsch? Ein Zwischenstand zum Disput um die Funde von Bernstorf, Archäologie in Deutschland 32, 2016, S. 62-65
Rupert Gebhard, Rüdiger Krause: Bernstorf. Archäologisch naturwissenschaftliche Analysen der Gold- und Bernsteinfunde, Frankfurter Archäologische Schriften, Verlag Dr. Rudolf Habelt 2016
Philip Ball: Old Gold – Or New? Nature Materials Vol.16 February 2017, S. 159
Ernst Pernicka, Chr.-Heinrich Wunderlich: Rezensionen, Rupert Gebhard und Rüdiger Krause: Bernstorf. Archäologisch-naturwissenschaftliche Analysen der Gold- und Bernsteinfunde vom Bernstorfer Berg bei Kranzberg, Oberbayern, Praehistorische Zeitschrift; 2017; 92(2): S. 428–462
Gregor Borg und Ernst Pernicka: Goldene Zeiten? – Europäische Goldvorkommen und ihr Bezug zur Himmelsscheibe von Nebra, Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 96 / 2017, S. 111-138
Kate Verkooijen: Report and Catalogue of the Amber found at Bernstorf, near Kranzberg, Freising district, Bavaria, Germany Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 96 / 2017, S. 139-230
Alfred Reichenberger: Rupert Gebhard u. Rüdiger Krause: Bernstorf. Archäologisch-naturwissenschaftliche Analysen der Gold- und Bernsteinfunde vom Bernstorfer Berg bei Kranzberg, Oberbayern, Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 96 / 2017, S. 543-550
Ernst Pernicka: Science versus Archaeology? The Case of the Bernstorf Fakes. Metalla Nr. 24.2 / 2018, S. 73–80
Friedrich E. Wagner, Rupert Gebhard, Weimin Gan, Michael Hofmann: The metallurgical texture of gold artefacts found at the Bronze Age rampart of Bernstorf (Bavaria) studied by neutron diffraction, Journal of Archaeological Science: Reports 20 (2018), S. 338-346
Rüdiger Krause, Rupert Gebhard: Das Narrativ von Bernstorf: Wissenschaftliches und Postfaktisches zu den Gold- und Bernsteinfunden, 2019, Archäologische Informationen, im Druck für Jahrgang 42, 2019
Daniel Berger, Michael Brauns, Gerhard Brügmann, Ernst Pernicka, Nicole Lockhoff: Revealing ancient gold parting with silver and copper isotopes: implications from cementation experiments and for the analysis of gold artefacts, Archaeological and Anthropological Sciences (2021) 13, 143
Richard Fuchs: Archäometrie – Wie Naturwissenschaftler
Geschichtsfälschungen aufspüren, SWR2, Sendung 12.10. 2022, 8.30 Uhr
https://bronzezeit-bayern-museum.de/de/museum/das-museum